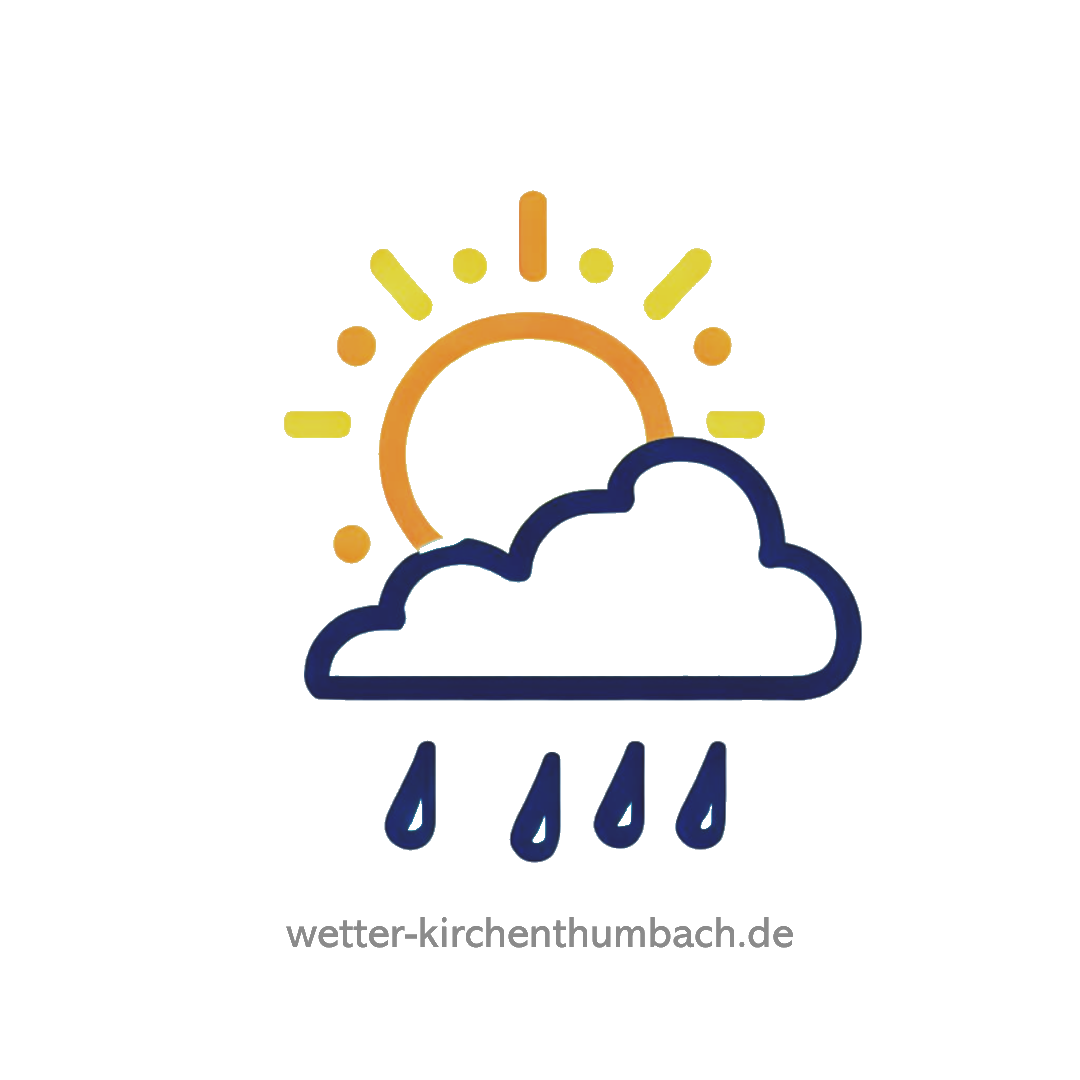Thema des Tages
Wissenschaft kompakt
Unsere Dampfkugel
Eine im Vergleich zur Erdkugel dünne Schicht aus Gasen umhüllt unseren Planeten. Durch Sie wird unser aller Leben überhaupt erst ermöglicht. Die Rede ist natürlich von der Atmosphäre.
Ach was muss das für ein wunderbarer Anblick sein, aus dem Weltraum auf die Erde herunterzublicken und ihrer ganzen Pracht ansichtig zu werden! Zumindest Bilder davon stehen uns von verschiedensten Satelliten zur Verfügung: Weiße schneebedeckte Flächen, blaue Meeresflächen, grüne Vegetationsgebiete und gelblich-braune Wüsten, darüber liegend weiße Wolkengebilde. Am Rande jener riesigen Kugel ist ein dünner, manchmal bläulich schimmernder Mantel zu sehen. Diese zerbrechlich wirkende mit Gas gefüllte Einhüllende ist unsere Atmosphäre und erlaubt uns auf diesem Planeten zu leben. Der Name leitet sich aus dem altgriechischen "atmós" - Dampf und "sphaira" - Kugel ab.
Über Jahrmilliarden, hat sich ihr uns heute vertraute Aufbau und Zusammensetzung entwickelt. In der Vertikalen kann eine Unterteilung in die "Homosphäre" und darüber die "Heterosphäre" vorgenommen werden. In Erstgenannter sind die verschiedenen Komponenten der Luft gut durchmischt. Den größten Anteil am Gasgemisch machen hierbei Stickstoff, Sauerstoff und Argon (etwa 78 %, 21 % und 1 %) aus. Dazu gesellen sich noch Spurengase, das wohl prominenteste ist Kohlenstoffdioxid, aber es zählen auch beispielsweise Methan oder Lachgas dazu. Der Wasserdampfgehalt der Luft ist sehr variabel, spielt aber natürlich ebenso eine wichtige Rolle für allerlei Prozesse wie Wolkenbildung oder den Strahlungshaushalt. Am Oberrand wird diese Homosphäre von der "Homopause", oder auch "Turbopause"
genannt, begrenzt. Daran schließt sich ab einer Höhe von etwa 100 km die Heterosphäre an. Dort trennen sich die Bestandteile der Luft mit der Höhe auf. Leichtere Moleküle bzw. Atome wie Wasserstoff können auch in größerer Höhe von der Schwerkraft gehalten werden, während beispielsweise der schwere Sauerstoff nur in niedrigerer Höhe von der Erde gehalten werden kann.
Eine andere Unterteilung fokussiert sich auf den Einfluss des Bodens durch Reibung. Hier erstreckt sich die Prandtlschicht über die ersten
50 m und zeichnet sich dadurch aus, dass die Windgeschwindigkeit logarithmisch mit der Höhe zunimmt. Daran anschließend erstreckt sich die Ekmanschicht bis etwa 1 km. Charakteristisch für diese Schicht ist zusätzlich eine Winddrehung mit der Höhe nach rechts (auf der Südhalbkugel nach links) durch den abnehmenden Einfluss der Bodenreibung. Prandtl- und Ekmanschicht zusammengefasst, werden auch als planetare Grenzschicht bezeichnet. In der freien Atmosphäre darüber spielen die erwähnten Bodeneinflüsse keine Rolle mehr.
Die wohl bekannteste Aufteilung leitet sich jedoch vom Temperaturverlauf ab. Fünf Schichten werden unterschieden:
Troposphäre, Stratosphäre, Mesosphäre, Thermosphäre und Exosphäre.
Die Grenzflächen werden entsprechend Tropopause, Stratopause, ...
genannt. Was zeichnet die einzelnen Sphären aus? Welche Unterschiede bestehen zwischen Ihnen? Die Antworten auf diese Fragen benötigen ein separates Thema des Tages.
M.Sc. Fabian Chow
Deutscher Wetterdienst
Vorhersage- und Beratungszentrale
Offenbach, den 17.10.2025
Copyright (c) Deutscher Wetterdienst