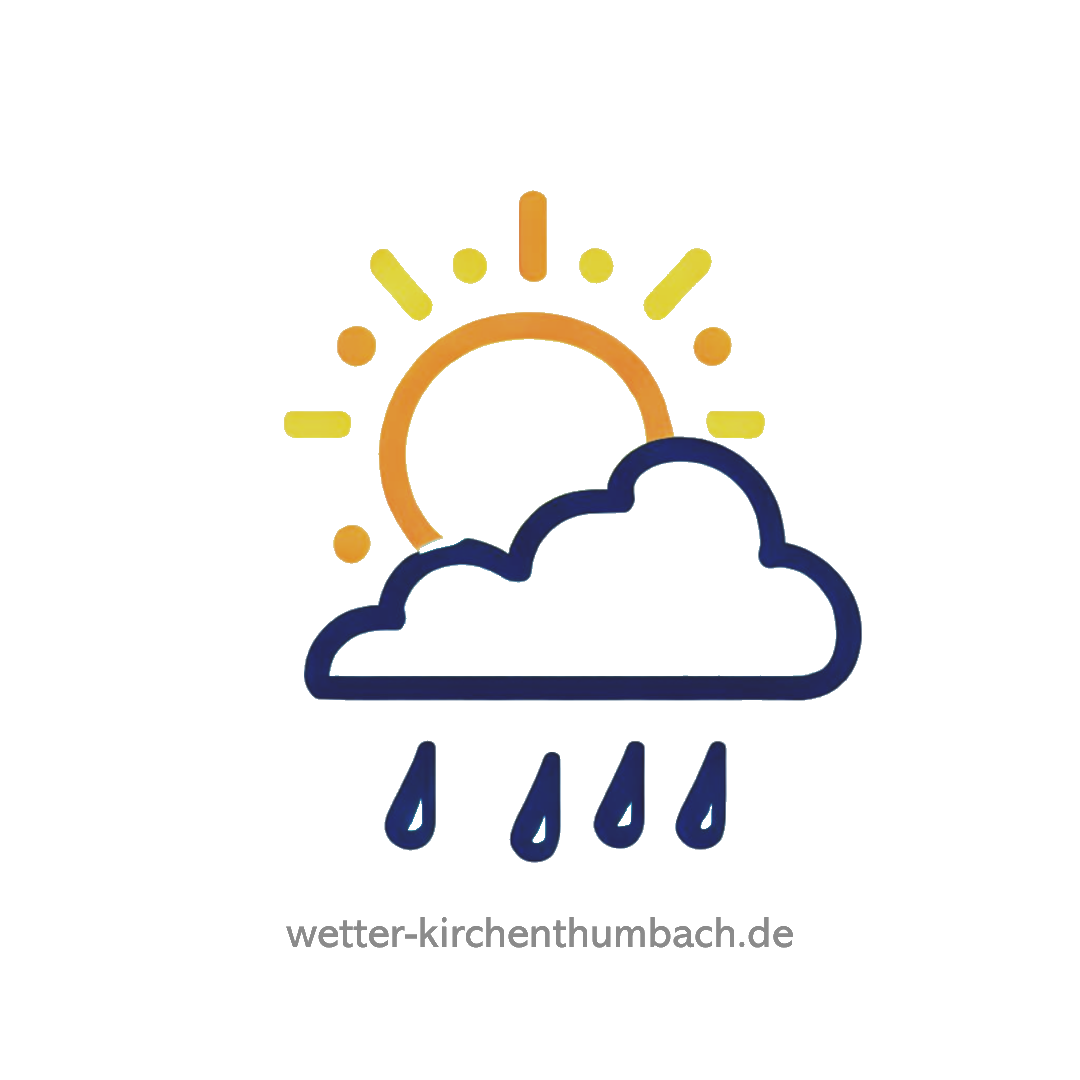Thema des Tages
Wissenschaft kompakt
Knoblauch: Der Wetterflüsterer im Beet
Was hat Knoblauch mit dem Wetter zu tun? Mehr als man denkt! Zum
Osterfest werfen wir einen würzigen Blick auf die beliebte Knolle.
Am Ostersonntag gibt?s bei vielen Schokohasen, Eier und vielleicht
auch Lamm. Letzteres wird nach Meinung einiger Hobbyköche vor allem
durch eine Zutat zum Fest: Knoblauch. Also tief durchatmen und rein
in die würzige Welt "zwischen Feld und Forecast"!
Beginnen wir mit einem Klassiker: Bauernregeln. In vielen alten
Kalendern hieß es sinngemäß: "Wächst der Knoblauch fett und rund,
bleibt der Sommer mild und gesund." Nun ja, wissenschaftlich belegt
ist das nicht- aber es zeigt: Knoblauch wurde lange als eine Art
pflanzliches Wetterorakel betrachtet. Tatsächlich reagiert die
Pflanze recht sensibel auf Witterungseinflüsse. Sie bevorzugt kühle
Temperaturen beim Austrieb und wärmere, trockene Bedingungen zur
Reife. Ein feuchter Sommer? Schlechte Nachricht für Knoblauch-Fans-
das gibt eher mickrige Zehen und erhöht die Gefahr von Schimmel oder
Fäulnis. Eine stabile Hochdrucklage hingegen lässt die Knollen
gedeihen.
Wetter beeinflusst nicht nur das Wachstum, sondern auch den
Geschmack. Denn meteorologische Bedingungen steuern die Bildung von
sekundären Pflanzenstoffen wie Allicin. Diese sind für den
charakteristischen Duft verantwortlich, der zuverlässig Vampire,
erste Dates (und manchmal auch Schwiegermütter) fernhält. Studien
zeigen: In Regionen mit viel Sonne und eher trockenen Böden ist der
Gehalt dieser Verbindungen höher- das bedeutet mehr Geschmack, aber
auch mehr Geruch. Wer also je das Gefühl hatte, dass Knoblauch aus
südlichen Ländern intensiver schmeckt, lag vollkommen richtig!
Ob im Beet, in der Pfanne oder als olfaktorisches Statement beim
Osterbrunch: Knoblauch lebt im Takt des Wetters. Und gerade zu
Ostern? wenn Lammbraten, Kartoffelgratin und allerlei Geselligkeit
auf dem Tisch stehen- darf er ruhig mal glänzen. Übrigens: In den USA
wurde erst gestern der "National Garlic Day" gefeiert. In diesem
Sinne: Auf das Wetter- das uns nicht nur beim Osterbrunch
Gesprächsstoff liefert- und auf die Knolle, die zeigt, dass man
selbst bei Aprilwetter würzig, robust und ein bisschen eigensinnig
sein darf. Frohe Ostern!
Dipl.-Met. Magdalena Bertelmann
Deutscher Wetterdienst
Vorhersage- und Beratungszentrale
Offenbach, den 20.04.2025
Copyright (c) Deutscher Wetterdienst
Dieser Newsletter wird ohne Grafiken verschickt. Falls im Text Bezug auf Abbildungen genommen wird, können Sie die Grafiken und Bilder unter www.dwd.de/tagesthema finden.
Weitere interessante Themen zu Wetter und Klima finden
Sie auch im DWD-Wetterlexikon unter: www.dwd.de/lexikon
Wissenschaft Kompakt
Satellitenmeteorologie (Teil 1) ? Die 12 Augen der Wettersatelliten
Wettersatelliten sind ein essenzielles Hilfsmittel in der Wetteranalyse. Heute geben wir einen kurzen Einblick, was Wettersatelliten alles "sehen" können.
Wettersatelliten sind in der heutigen modernen Meteorologie nicht mehr wegzudenken. Sie liefern zum einen wichtige Beobachtungsdaten für Wettervorhersagemodelle, die für eine präzise numerische Wettervorhersage unerlässlich sind. Mit ihrem Blick aus dem Weltall auf unsere Erde leisten sie außerdem unschätzbare Dienste bei der Wetteranalyse und der Kürzestfristvorhersage. Unter letzterem versteht man die Vorhersage des Wetters der kommenden Stunden, für die man nicht zwangsläufig Vorhersagemodelle benötigt. Die Satelliten machen alle 15 Minuten Aufnahmen von unserer Erde, die uns Meteorologen einen schnellen Überblick geben, wo sich beispielsweise aktuell in der Atmosphäre Wolken befinden. Auf einem Blick können wir so Tiefdruckgebiete identifizieren, um die sich die Wolkenbänder schlängeln. Mittels zeitlicher Abfolge vergangener Bilder können wir sogar abschätzen, in welche Richtung sich die Wolken und die dazugehörigen Tiefs bewegen werden, ob sich die Wolken auflösen oder verdichten, wo in Kürze Gewitter entstehen könnten und vieles mehr.
Im heutigen Tagesthema zeigen wir, was Wettersatelliten alles sehen bzw. messen können. (Auf die der Satellitenmeteorologie zugrunde liegenden Strahlungstransporttheorie soll an dieser Stelle bewusst verzichtet werden, damit auch Leserinnen und Leser ohne Physikstudium oder Physikleistungskurs nicht den Durchblick verlieren.) Das wichtigste Messgerät der der Wettersatelliten ist das sogenannte Radiometer, das die von der Erde zurückgesandte Strahlung misst. Ein Radiometer ist eine Art Multifunktions-Kamera, die weit mehr aufnehmen kann als unser menschliches Auge, nämlich die von der Erde abgegebene Strahlung im solaren (sichtbaren) und infraroten
Stellen Sie sich vor, Sie wären ein Astronaut und blicken von der ISS auf die Erde. Was Sie sehen würden, ist ein Abbild unseres blauen Planeten im für das menschliche Auge sichtbaren (solaren) Spektralbereich (Wellenlängen zwischen 380 und 780 Nanometer). Unser Auge erkennt also eine ganze Bandbreite an Wellenlängen, die es unterschiedlichen Farben zuordnet. Die Radiometer der Wettersatelliten funktionieren nach einem ähnlichen Prinzip, nur bestehen sie nicht nur aus einem "Auge", sondern aus gleich zwölf Augen, den sogenannten Kanälen. Jeder der zwölf Kanäle empfängt einen bestimmten von der Erde emittierten Wellenlängenbereich. Die Kanäle messen dabei die Intensität der empfangenen Strahlung, ohne diese Farben zuzuordnen. So entstehen Schwarz-Weiß-Bilder, bei denen weiß eine hohe Strahlungsintensität und schwarz eine geringe Strahlungsintensität bedeutet. Drei der zwölf Kanäle empfangen - ähnlich zum menschlichen Auge - Strahlung im solaren (kurzwelligen) Bereich, aber mit einer jeweils kleineren Bandbreite als unser Auge.
Weitere acht Kanäle empfangen Strahlung im thermischen (langwelligen) Strahlungsbereich und damit Informationen, die unser Auge nicht erfassen kann. Jeder dieser elf Kanäle sieht für sich betrachtet zwar weniger als unser Auge, in der Kombination aller Kanäle erfasst ein Radiometer aber weitaus mehr Informationen von der Erde als der sehende Mensch. Das zwölfte Auge des Radiometers, der HRV-Kanal (High Resolution Visible), ist das Adlerauge unter den Kanälen, es sieht besonders scharf, also mit einer höheren Auflösung im gesamten sichtbaren Spektralbereich.
Im nächsten Teil dieser Reihe erfahren Sie, wie man mit einer geschickten Technik farbige Bilder erzeugen kann, die den Meteorologen weitere Möglichkeiten die Wetteranalyse bieten.
Dr. rer. nat. Markus Übel
Deutscher Wetterdienst
Vorhersage- und Beratungszentrale
Offenbach, den 07.05.2024
Copyright (c) Deutscher Wetterdienst
Wetter aktuell
Ungewöhnlich warmes erstes Aprilwochenende!
Viel Sonnenschein und frühsommerliche Temperaturen, so gestaltete sich das erste Aprilwochenende. Örtlich wurde sogar der erste Hitzetag erreicht. Warum die Tageshöchsttemperaturen dennoch etwas gedämpft wurden, dazu mehr im heutigen Thema des Tages.
Am gestrigen Samstag wurde in der Mitte und im Süden Deutschlands verbreitet ein Sommertag mit Höchsttemperaturen von über 25 Grad verzeichnet. In Ohlsbach gab es sogar den ersten Hitzetag mit einem Spitzenwert von 30,1 Grad. Damit wurden dort sowie an vielen anderen Stationen Temperaturen erreicht, die bisher in der ersten Aprildekade noch nie auftraten. Zudem gab es noch nie so früh im Jahr einen Hitzetag mit einer Tageshöchsttemperatur von mindestens 30 Grad.
Verantwortlich für diese bemerkenswerte warme Witterung ist ein langwelliger Höhentrog über Westeuropa in Verbindung mit einem kräftigen Sturmtief bei Irland. Auf der Vorderseite des Tiefs gelangt sehr warme bis heiße Luft von Nordafrika bis nach Mitteleuropa. So liegt die Temperatur in 850 Hektopascal (etwa 1500 Meter Höhe) im Süden Deutschlands bei bis zu 18 Grad. Da sich erst im Laufe des Samstags im Westen Saharastaub bemerkbar machte, konnte sich die Luftmasse durch überwiegend ungestörte Sonneneinstrahlung auch in Erdbodennähe noch ordentlich erwärmen. Denn Saharastaub hat einen dämpfenden Einfluss auf die Tageshöchsttemperaturen. Zum einen wird die von der Sonne ausgehende kurzwellige Strahlung an den Staubpartikeln reflektiert und zum anderen fördern die Aerosole die Ausbildung von hohen Wolkenfeldern. Durch die fehlende Einstrahlung wird das volle Potenzial einer Luftmasse nicht ganz ausgenutzt.
Zuvor dominierte gestern um die Mittagszeit noch größtenteils ungetrübter Sonnenschein. Erst im Laufe des Nachmittags stieg die Saharastaubkonzentration im Westen deutlich an. Dies hatte aber nur noch einen geringen Einfluss auf die Temperaturentwicklung, wodurch rekordverdächtig hohe Werte erreicht wurden. In der Nacht auf Sonntag hatte der Saharastaub allerdings den gegenteiligen Effekt. Durch verstärkte Wolkenbildung zusammen mit einem teils böigen Südwind war die nächtliche Abkühlung nur schwach ausgeprägt. Vor allem an den Nordrändern der Mittelgebirge kamen zusätzlich noch Föhneffekte hinzu. Somit wurde im Umfeld des Harzes sogar örtlich eine Tropennacht mit einer Tiefsttemperatur von über 20 Grad verzeichnet.
Auch am heutigen Sonntag hält das frühsommerliche Wetter an. Von Nordwesten nimmt der Tiefdruckeinfluss allmählich zu. An einer wellenden Kaltfront kann in der Nordwesthälfte etwas Regen fallen.
Nach Südosten überwiegt der Hochdruckeinfluss. Allerdings fördert dort die hohe Konzentration an Saharastaub die Wolkenbildung, sodass die Höchsttemperaturen im Vergleich zum Vortag etwas geringer ausfallen werden. Dennoch zeigt das Thermometer abgesehen vom äußersten Norden und Nordwesten in den Niederungen verbreitet Temperaturen um 25 Grad an. Im Süden und Osten sind stellenweise auch rekordverdächtige Werte bis 28 Grad möglich. Erst in der kommenden Woche machen sich von Nordwesten sukzessive deutliche kühlere Luftmassen bemerkbar. Bis dahin zeigt sich der April aber von seiner frühsommerlichen Seite.
M.Sc.-Met. Nico Bauer
Deutscher Wetterdienst
Vorhersage- und Beratungszentrale
Offenbach, den 07.04.2024
Copyright (c) Deutscher Wetterdienst
Wetter aktuell
Die Wüste auf Osterbesuch
Die ausgeprägte Saharastaub-Wolke am gestrigen Ostersamstag war in aller Munde - und das quasi wortwörtlich, betrachtet man sich die Feinstaubkonzentration in der Luft. Ein Rückblick.
Nahezu überall in Deutschland konnte am gestrigen Ostersamstag
(30.04.2024) die mächtige Saharastaub-Wolke beobachtet werden, die sich über das Land gelegt hat. Besonders eindrucksvoll spiegelte sich das in den mitunter ziemlich fremdartigen Lichtstimmungen wider. Sei es tagsüber bei milchig-bräunlichem Himmel, durch den sich die Sonne höchstens mit Mühe durchkämpfen konnte, oder in Form von strahlend-intensiven Sonnenuntergängen dort, wo sich die Bewölkung schon etwas gelichtet hatte. Zahlreiche fotografische Nutzermeldungen in der DWD-WarnWetter-App belegten das eindrücklich.
Wie aber kam es überhaupt zu der Situation? Hauptverantwortlich dafür war ein riesiger Tiefdruckkomplex mit Zentrum über dem nahen Atlantik. Dieser reicht an seiner Südseite bis weit nach Nordafrika herein, wo sich aufgrund des damit verbundenen Windes große Staubwolken am Rande der Sahara bilden konnten. Diese Wolke wurde dann entlang der südöstlichen Flanke dieses Tiefdruckkomplexes nach Norden über die Alpen hinweg nach Deutschland sowie angrenzende Nachbarländer verfrachtet. Die seit Tagen anhaltende kräftige Südströmung, die bei uns unter anderem für milde Temperaturen und kräftigen Föhn an den Alpen sorgte, war dafür prädestiniert.
Vielerorts aber schaffte es die Sonne gar nicht mehr durch die dicke Wolkendecke und sorgte für recht trübe Verhältnisse. Das machte sich unter anderem bei den Höchsttemperaturen des Tages bemerkbar, die verbreitet deutlich unter dem blieben, was die Vorhersagemodelle, die vom Wüstenstaub nichts "wussten", prognostizierten. Oftmals waren auch die Sichtweiten deutlich herabgesetzt. Das war ein Hinweis darauf, dass sich auch in den niedrigen atmosphärischen Schichten allerhand Saharastaub befand. Dass dem tatsächlich so war, stellt man bei Betrachtung der Feinstaub-Messwerte schnell fest. Repräsentativ ist hier die die Größe "PM10", die die Massekonzentration an Feinstaubpartikeln mit einem aerodynamischen Durchmesser von ?10µm angibt. Hierbei ist bundesweit ein Grenzwert von 50µg/m³ im Tagesmittel definiert, das höchstens an 35 Tagen pro Jahr überschritten werden darf.
Dieser Wert wurde nun am gestrigen Ostersamstag in großen Teilen des Landes überschritten und lag stellenweise beim zwei- bis dreifachen des Grenzwertes. Wer sich also fragt, warum ihm vielleicht gestern der Hals gekratzt hat oder öfter als üblich einen Husten verspürt hat, könnte somit in der schlechten Luftqualität eine mögliche Erklärung finden.
Am heutigen Ostersonntag haben sich nun mittlerweile große Teile der Saharastaubwolke verflüchtigt. Die Luftqualität allerdings ist vor allem in Bayern und Mitteldeutschland noch immer recht miserabel und wird sich wohl erst in den kommenden Tagen wieder bessern. Ansonsten heißt es erstmal wieder: Durchatmen. In diesem Sinne wünschen wir unseren Leserinnen und Lesern frohe Restostern!
M.Sc. Felix Dietzsch
Deutscher Wetterdienst
Vorhersage- und Beratungszentrale
Offenbach, den 31.03.2024
Copyright (c) Deutscher Wetterdienst
Wetter aktuell
Was ist an Ostern alles möglich?
Nur noch wenige Tage bis Ostern. Also Zeit dafür, aufs Osterwetter zu blicken. Doch heute soll es darum gehen, was an Ostern in der Vergangenheit alles geboten wurde. Von Schnee bis Sommerwetter war schon alles dabei. Mehr dazu im heutigen Thema des Tages.
Das Osterwetter erfreut sich einer besonders großen Varianz, denn nahezu alles ist möglich. Von Dauerregen, über heftige Gewitter, Sturm und Schneefall bis hin zu sommerlichen Temperaturen ist an Ostern alles möglich. Grund dafür ist unter anderem der schwankende Zeitpunkt des Osterfests. Der früheste Ostersonntag ist mit dem 22.03. schon Ende März, während der späteste erst auf den 25. April fällt. Das allein sorgt dafür, dass spätere Ostertermine tendenziell eher wärmer sind als die, die Ende März liegen. Entsprechend ist die Wahrscheinlichkeit für schneebedeckte Ostern Ende März größer als Ende April.
Sehr schneereich waren beispielsweise die Jahre 1967, 1968,1970 und
1988 in den Mittelgebirgen, denn teilweise wurde 100 bis 200 cm, 1988 auch am Großen Arber über 350 cm der weißen Pracht gemessen. Im Jahre
1970 gab es im Osten und Nordosten des Landes sogar im Tiefland eine
5 bis 15 cm mächtige Schneedecke. Beispielsweise meldeten am Ostersonntag Berlin 10 cm und Chemnitz (Sachsen) 9 cm. In der jüngeren Vergangenheit gab es 2008 über der breiten Mitte weiße Ostern bis ins höhere Flachland. Außerdem muss das Jahr 2018 genannt werden. Hier fiel das Osterfest auf Anfang April. Über den Nordosten des Landes zog ein Tiefdruckgebiet hinweg, an dessen Nordflanke es rund um die Ostsee zu kräftigen Schneefällen kam. Verbreitet akkumulierte sich dort die Schneedecke auf 20 bis 35 cm.
Besonders warm präsentierte sich das Osterfest 2000 im Osten.
Verbreitet wurden 25 bis 30 °C erreicht. Spitzenreiter war Potsdam mit 30,0 °C am Ostersonntag (23.04.). Dies entspricht sogar einem heißen Tag. Sehr warm war es auch am Osterfest 1962. Dort fiel der Ostersonntag auf den 22.04. und in der Südosthälfte kletterte das Thermometer auf Höchstwerte zwischen 25 und 29 °C. Beispielsweise gab es in Roth bei Nürnberg (Bayern) 29,2 °C und in Potsdam (Brandenburg)
29,0 °C. 2019 und 2020 fiel Ostern im Westen und Südwesten sehr warm aus. In diesen Jahren wurde an einigen Stationen ein Sommertag mit Höchstwerten über 25 °C erreicht. Spitzenreiter am Ostersonntag war dabei Rheinau-Memprechtshofen (Baden-Württemberg) am 21.04.2019 mit
26,9 °C. Übertrumpft werden die Werte vom Jahr 1949, denn da gab es beispielsweise in Bernkastel-Kues unfassbar warme und schweißtreibende 31,2 °C am Ostersonntag (17.04.).
Die kältesten Osterfeste datieren aus den Jahren 1964, 1977, 2008 und 2013. In diesen Jahren lagen die Höchstwerte nur im niedrigen einstelligen Bereich. Insbesondere in den Mittelgebirgen herrschte oftmals Dauerfrost und im Jahr 2013 kletterte die Temperatur in der gesamten Mitte am Ostersonntag (23.03) nicht über den Gefrierpunkt.
Beispielsweise lag an diesem Tag das Maximum selbst in Erfurt
(Thüringen) nur bei -1,0 °C. Auch die Nächte waren an diesem Osterfest empfindlich frisch. Verbreitet trat leichter bis mäßiger, in einigen Mittelgebirgen auch strenger Frost unter -10 °C auf.
Ungewöhnlich nass war es an Ostern 1986. In einigen Gebieten fielen in diesem Jahr über die Feiertage hinweg in der Mitte, dem Westen und Südwesten 40 bis 80 l/qm. Dies entspricht dem gesamten durchschnittlichen Monatsniederschlag. Den meisten Niederschlag verzeichnete Freiensteinau (Hessen) mit 61,4 l/qm in 24 Stunden.
Rekordwerte werden am diesjährigen Osterfest wahrscheinlich nicht verzeichnet werden. Wie das Osterwetter im Detail über die Bühne geht, wird im morgigen Thema des Tages erläutert. Ein grober Trend sei schon mal verraten. Er lautet: Mild bis sehr mild und wechselhaft.
Dipl.-Met. Marcel Schmid
Deutscher Wetterdienst
Vorhersage- und Beratungszentrale
Offenbach, den 26.03.2024
Copyright (c) Deutscher Wetterdienst
Diesen Artikel und das Archiv der "Themen des Tages"
finden Sie unter www.dwd.de/tagesthema